
Ein lebenslanges Wohnrecht ist ein rechtliches Instrument, das jemandem das Recht gibt, in einer Immobilie zu wohnen - bis zu seinem Tod. Der Besitzer der Immobilie bleibt der neue Eigentümer, aber der Berechtigte darf das Haus oder die Wohnung ohne Miete nutzen. Es ist kein Mietvertrag, kein Nießbrauch und auch kein Erbrecht. Es ist etwas Eigenes: eine persönliche Dienstbarkeit, die im Grundbuch eingetragen wird.
Diese Form der Sicherung wird vor allem von älteren Menschen genutzt, die ihre Immobilie an ihre Kinder übertragen wollen, aber weiterhin dort wohnen möchten. Statt die Immobilie zu verkaufen oder zu vererben, geben sie sie als Geschenk ab - aber mit einem wichtigen Vorbehalt: Sie behalten das Recht, dort zu leben. Das ist praktisch, weil es steuerlich günstiger ist als eine Vererbung und gleichzeitig eine klare Absicherung bietet.
Ein lebenslanges Wohnrecht entsteht nicht einfach durch eine mündliche Vereinbarung. Es muss notariell beurkundet werden. Das bedeutet: Ein Notar schreibt den Vertrag auf, erklärt beide Parteien, und beide unterschreiben vor ihm. Danach wird das Recht im Grundbuch eingetragen - genauer gesagt in Abteilung II, wo persönliche Dienstbarkeiten stehen.
Diese Eintragung ist entscheidend. Ohne sie hat das Wohnrecht keine rechtliche Wirkung. Wenn der neue Eigentümer die Immobilie später verkauft, bleibt das Wohnrecht bestehen. Der neue Käufer muss den Bewohner weiterhin wohnen lassen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber einem einfachen Mietvertrag, der bei Eigentümerwechsel enden könnte.
Das Wohnrecht ist nicht übertragbar. Das heißt: Du kannst es nicht an deine Tochter verkaufen, nicht an einen Pflegedienst verleihen und auch nicht vererben. Es stirbt mit dir. Auch wenn du in eine Pflegeeinrichtung ziehst, darfst du nicht einfach jemand anderen in deine Wohnung ziehen - es sei denn, der neue Eigentümer stimmt ausdrücklich zu. Das ist ein großer Nachteil, wenn sich die Lebensumstände ändern.
Der Wert des Wohnrechts ist nicht der Wert der Immobilie. Er wird berechnet, wie viel Geld du sparen würdest, wenn du mietfrei wohnst - und das über deine verbleibende Lebenserwartung.
Die Berechnung basiert auf den Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes. Diese sagen voraus, wie lange ein Mensch mit einem bestimmten Alter voraussichtlich noch lebt. Für einen 70-jährigen Mann beträgt der Kapitalwertfaktor aktuell 10,397. Für eine Frau gleichen Alters ist er höher: 10,81. Das liegt an der längeren Lebenserwartung von Frauen.
Beispiel: Du wohnst in einer Wohnung, deren Kaltmiete in deiner Gegend 750 Euro pro Monat beträgt. Das sind 9.000 Euro pro Jahr. Multiplizierst du das mit dem Faktor von 10,397, ergibt das einen Wohnrechtswert von 93.573 Euro. Das ist der Wert, den das Finanzamt für die Steuererhebung ansieht.
Je älter du bist, desto geringer ist der Wert. Ein 80-Jähriger hat nur noch einen Faktor von 6,03. Das Wohnrecht ist dann nur noch rund 54.270 Euro wert. Das macht es für ältere Menschen besonders attraktiv - die Steuerlast sinkt mit dem Alter.
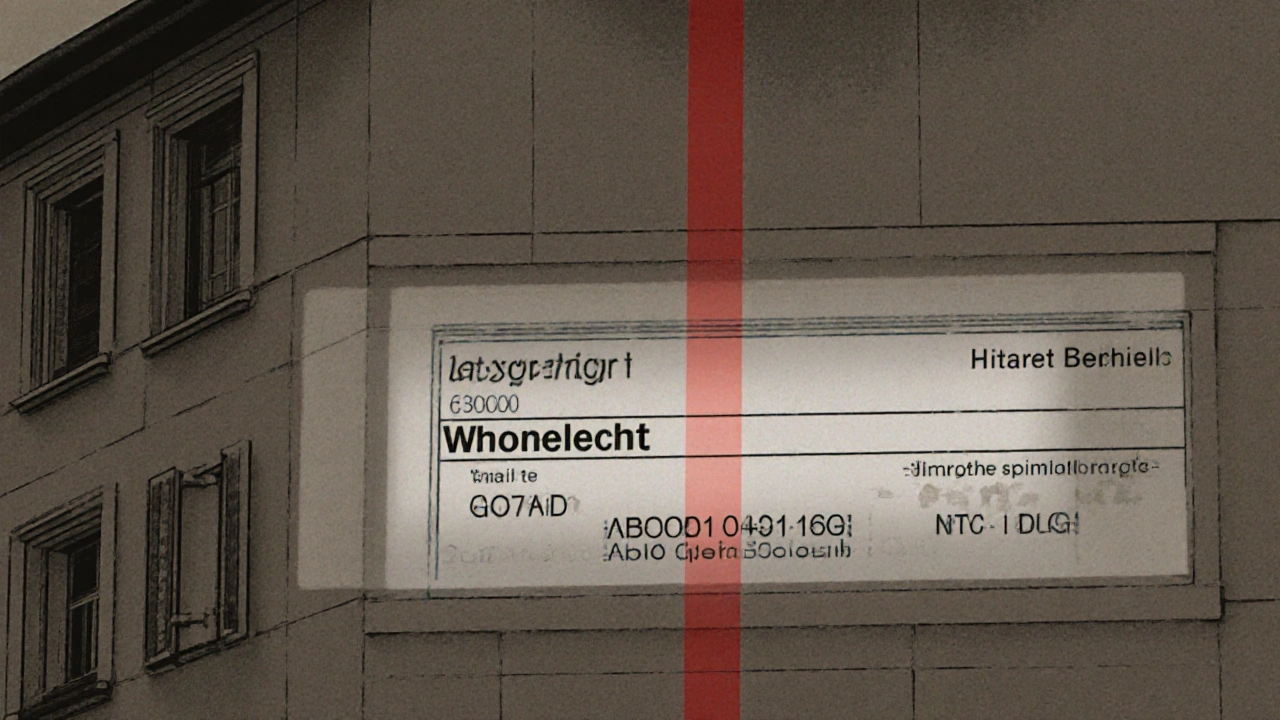
Wenn du deine Immobilie an deine Kinder verschenkst, fällt normalerweise Schenkungssteuer an. Aber: Der Wert des Wohnrechts wird vom Gesamtwert der Immobilie abgezogen. Das reduziert den steuerpflichtigen Betrag.
Angenommen, deine Immobilie ist 500.000 Euro wert. Du räumst ein Wohnrecht mit einem Wert von 93.573 Euro ein. Der steuerpflichtige Teil ist dann nur noch 406.427 Euro. Bei einem Steuersatz von 20 % (für Kinder in Steuerklasse I) zahlst du statt 100.000 Euro nur noch 81.285 Euro. Das sind 18.715 Euro Ersparnis.
Im Vergleich zum Nießbrauch ist das Wohnrecht deutlich günstiger. Der Nießbrauch erlaubt nicht nur das Wohnen, sondern auch die Vermietung, die Nutzung von Gärten oder die Verwertung von Erträgen. Deshalb wird er höher bewertet - und führt zu weniger Steuerersparnis. Nur 28 % der Menschen wählen den Nießbrauch, weil er teurer ist.
Wichtig: Das Wohnrecht wird auch dann besteuert, wenn es im Testament eingeräumt wird. Es zählt dann zum Erbe - nicht zur Schenkung. Die Steuergesetze sind hier identisch.
Beide Rechte erlauben es jemandem, eine Immobilie zu nutzen - aber sehr unterschiedlich.
Das macht den Nießbrauch für Investoren attraktiv. Aber für Eltern, die nur sicherstellen wollen, dass sie weiterhin im Haus wohnen, ist er überdimensioniert und teuer. Der Wert des Nießbrauchs liegt oft 30-50 % höher als der des Wohnrechts. Das bedeutet: Weniger Steuerersparnis.
Ein weiterer Unterschied: Der Nießbrauch ist vererbbar. Wenn du stirbst, kann dein Erbe weiterhin nutzen. Das Wohnrecht stirbt mit dir. Das ist für viele Eltern kein Problem - sie wollen ja nicht, dass ihre Kinder nach ihrem Tod weiterhin wohnen. Sie wollen nur, dass sie selbst sicher sind.
Obwohl das Wohnrecht viele Vorteile hat, gibt es auch Fallstricke.
Ein großes Problem: Wer zahlt für Reparaturen? Der Gesetzgeber hat das nicht geregelt. Wenn die Heizung kaputtgeht, muss der Eigentümer sie ersetzen - oder der Bewohner? In der Praxis entstehen daraus oft Streitigkeiten. 22 % der Konflikte bei Wohnrechten drehen sich um Modernisierungen und Instandhaltung.
Ein weiteres Problem: Was passiert, wenn du in eine Pflegeeinrichtung ziehst? Das Haus steht leer. Der neue Eigentümer könnte dich auffordern, das Wohnrecht aufzugeben - aber er darf es nicht. Du hast das Recht, dort zu wohnen - auch wenn du nicht da bist. Aber du kannst es nicht verpachten. Du hast keine Einnahmen. Das ist eine finanzielle Belastung.
Ein weiteres Risiko: Wenn du das Haus verkaufst, musst du es mit Wohnrecht verkaufen. Das senkt den Verkaufspreis. Käufer zahlen weniger, weil sie wissen: Der alte Bewohner bleibt. Das ist kein Problem, wenn du deine Kinder als Käufer hast. Aber wenn du später jemanden außerhalb der Familie verkaufen willst, ist das schwierig.

Die meisten Nutzer sind Eltern über 65, die ihre Immobilie an ihre Kinder übertragen. Laut einer Umfrage von Deutsche Teilkauf (2023) nutzen 42 % dieser Gruppe ein lebenslanges Wohnrecht. Der Hauptgrund? Steuerersparnis. 78 % der Befragten nannten das als Hauptmotiv.
Die Nachfrage wächst. Experten rechnen mit einem jährlichen Anstieg von 12 % bis 2027. Die Bevölkerung altert, Immobilien sind oft das größte Vermögen, und viele wollen vermeiden, dass ihre Kinder hohe Steuern zahlen müssen.
Die Bundesregierung prüft gerade, ob die Bewertungsmethode angepasst werden soll - etwa durch höhere Faktoren für ältere Menschen. Das könnte die Steuerersparnis noch weiter erhöhen.
Wenn das Wohnrecht zu starr ist, gibt es andere Optionen.
Die meisten Menschen wählen das Wohnrecht, weil es die beste Balance zwischen Sicherheit, Kontrolle und Steuervorteil bietet. Es ist nicht perfekt - aber es ist die gängigste Lösung.
Wenn du überlegst, dein Haus zu verschenken und ein Wohnrecht einzuräumen:
Es ist kein einfacher Schritt - aber wenn du ihn richtig machst, sichert er dir ein sicheres Zuhause für den Rest deines Lebens - und entlastet deine Kinder von einer hohen Steuerlast.
Nein. Ein lebenslanges Wohnrecht ist streng persönlich und erlischt automatisch mit dem Tod des Berechtigten. Es kann nicht an Kinder, Enkel oder andere Erben übertragen werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Nießbrauch, der vererbbar ist.
Nein. Ein lebenslanges Wohnrecht ist grundsätzlich unentgeltlich. Du zahlst keine Miete, auch wenn der neue Eigentümer das Haus verkauft. Der neue Besitzer ist verpflichtet, dir das Wohnrecht zu gewähren - sofern es im Grundbuch steht.
Wenn die Immobilie unbewohnbar wird - etwa durch Abriss oder schweren Schaden - erlischt das Wohnrecht automatisch. Der Berechtigte hat dann keinen Anspruch mehr auf Ersatzwohnraum. Es sei denn, das Wohnrecht wurde mit einer Ersatzwohnung vereinbart - das ist aber selten und muss ausdrücklich im Vertrag stehen.
Nur mit Zustimmung des Eigentümers. Das Wohnrecht ist nicht übertragbar - aber der Eigentümer kann im Einzelfall erlauben, dass jemand anderes mit dir zusammenwohnt, etwa ein Pfleger. Das muss schriftlich festgehalten werden, sonst ist es rechtlich unsicher.
Ja. Ein lebenslanges Wohnrecht kann auch testamentarisch eingeräumt werden. Dann wird es Teil des Nachlasses. Der Wert wird wie bei einer Schenkung berechnet und in die Erbschaftssteuer einbezogen. Die Steuerersparnis funktioniert genauso wie bei einer Schenkung.
Also ich find's krass, dass man so was als 'Steuerersparnis' verkaufen kann. Das ist doch nur eine Umgehung des Systems. Die Leute sollen doch nicht ihre Häuser verschenken, nur weil die Steuern zu hoch sind. Das ist kaputt.
hast du schonmal dran gedacht dass die banken das alles geplant haben? die wissen genau dass leute ab 60 ihre häuser verschenken und dann später in die pflege kommen... und dann ist das haus weg. das ist systematisch. die regierung macht mit. #verschwörung
Wohnrecht: §1093 BGB. Wertberechnung gem. §14 ErbStG, Anlage 1, Tabellen 1-3. Faktor basiert auf Sterbetafel 2020/2022, ggf. mit Sterbegeschlechtskorrektur. Nicht vererbbar, nicht übertragbar, kein Nießbrauch. Grundbuchseintrag zwingend. Reparaturkosten: §1096 BGB, §535 BGB analog. Notar muss auf Risiken hinweisen.
Das klingt für viele Eltern wie eine riesige Erleichterung. Ich hab meine Oma gesehen, wie sie sich Sorgen gemacht hat, ob sie nach dem Verkauf noch ein Zuhause hat. Das hier gibt ihr Sicherheit. Einfach nur gut.
Ich hab das letztes Jahr mit meinen Eltern gemacht. 80k Steuern eingespart, sie wohnen noch im Haus, ich hab das Ding auf dem Papier. Keine Probleme. Einfach den Notar nicht sparen. Und klar, Reparaturen sind ein Thema – aber das regelt man im Vertrag. Einfach reden.
Es ist eine juristische Fiktion, die sozialen Realitäten nicht abbildet. Wer ein Wohnrecht hat, ist kein Eigentümer, aber auch kein Mieter. Er ist ein Zwischenwesen im Rechtssystem. Ein lebendiges Relikt aus einer Zeit, in der Familien noch zusammenlebten. Heute ist das ein juristischer Kompromiss – und kein Modell.
Ah ja, natürlich. Die armen Omas geben ihr Haus weg, damit ihre Kinder nicht 20k zahlen müssen. Und dann sitzen sie da, kalt, in der Wohnung, und warten, bis die Heizung kaputtgeht. Und wer zahlt? Die arme Oma. Und die Kinder? Die haben ihr Haus. Und die Bank? Die hat den Kredit. Wer gewinnt? Niemand. Nur die Notare.
WIE KANN MAN SO EINEN ARTIKEL SCHREIBEN UND NICHT ERWÄHNEN, DASS DAS WOHNRECHT AUCH BEI EINER ZWANGSAUFGABE DURCH DEN NEUEN EIGENTÜMER NICHT GELTEN WIRD?!!? DAS IST GEFÄHRLICH! JEDER, DER DAS LEST, SOLLTE EINEN ANWALT HOLEN! NICHT DEN NOTAR! DEN ANWALT!
Lebenslanges Wohnrecht. Cool. Ich hab auch ein Wohnrecht. In meinem Kopf. Von meiner Ex. Die sagt immer ich darf da wohnen. Aber ich darf nicht. Und das ist auch gut so.
Die Berechnung des Wohnrechts gemäß § 14 ErbStG in Verbindung mit der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ist unzureichend, da sie keine dynamischen Lebenserwartungsmodellierungen berücksichtigt. Eine stochastische Lebensdauerprognose unter Berücksichtigung von Komorbiditäten wäre erforderlich. Die aktuelle Methode ist archaisch und rechtswidrig.
Ich frage mich, ob das Wohnrecht nicht eigentlich ein Spiegel unserer Angst ist. Wir geben alles weg, damit wir uns sicher fühlen. Aber sind wir es dann wirklich? Oder leben wir nur in einer Illusion aus Papier und Notariatsstempeln?
DIE DEUTSCHEN. GEBEN IHRE HÄUSER WEG, DAMIT IHR KINDER NICHT STEUERN ZAHLEN MÜSSEN. ABER WENN EIN NORWEGER DAS TUT, WIRD ER ALS VERRÄTER BEZEICHNET. WAS IST DAS FÜR EIN EINLAND? WIR HABEN EINEN STAAT DER SICH SELBST VERKAUFT.
und wusstest du dass die regierung im hintergrund die sterbetafeln manipuliert hat? die zahlen sind gefälscht. die wollen dass du dein haus gibst. sonst wärst du arm. und die wollen dass du arm bist. sonst wären sie nicht reich. #geheimdienst
Ich find’s eigentlich ziemlich clever. Man gibt etwas ab, behält aber das Wesentliche. Das ist wie bei Freundschaften – du vertraust, aber du bleibst du. Und wenn die Heizung kaputtgeht? Dann redet man. Menschlich. Einfach.
Falsch: Ein lebenslanges Wohnrecht wird nicht in Abteilung II eingetragen, sondern in Abteilung III, da es sich um ein persönliches Dienstbarkeitsrecht handelt. Abteilung II ist für dingliche Rechte. Korrigieren Sie das, bitte.
Die ganze Geschichte ist ein perfektes Beispiel für die Verquickung von Recht, Kapital und sozialer Kontrolle. Sie geben Ihr Haus weg, um Steuern zu sparen – und verlieren Ihre Autonomie. Sie werden zum passiven Objekt in einem System, das Sie nicht mehr kontrollieren. Und dann wundern Sie sich, warum Sie sich einsam fühlen.
Interessant, wie wir alle so sehr auf Steuern fokussiert sind. Aber was ist mit dem Wert des Lebens? Wenn du dein Haus behältst, hast du Kontrolle. Wenn du es verschenkst, hast du Vertrauen. Welchen Wert gibst du mehr? Die Steuerersparnis ist nur ein Zahlenwert. Das Vertrauen ist es nicht.

Mär 18 2025